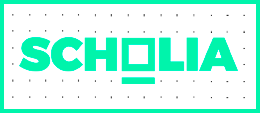3. Dezember 2025 : 11:00 - 12:10
Moderation: Katharina Schulz (Fachhochschule Potsdam)
Veranstaltungsraum: RAUM B
11:00 - 11:20 Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das Forschungsdatenmanagement
Annette Strauch-Davey (Universität Witten/Herdecke)Veranstaltungsraum: RAUM B
In unserer Zeit, die von hybrider Kriegsführung, Autokratisierung und geopolitischen Spannungen geprägt ist, hat Wissenssicherheit neue Relevanz gewonnen. Forschungsinfrastrukturen als eine Voraussetzung für Innovation. Wie offen können sie sein?
In unserer Zeit, die von hybrider Kriegsführung, Autokratisierung und geopolitischen Spannungen geprägt ist, hat Wissenssicherheit neue Relevanz gewonnen. Forschungsinfrastrukturen als eine Voraussetzung für Innovation. Wie offen können sie sein? Für ein effektives Forschungsdatenmanagement sind nicht nur Datenstrukturen notwendig, sondern auch Forschungssoftware, Hardware, Rechenleistung, Speicherkapazitäten sowie digitale Kompetenzvermittlung. All diese Komponenten sind entscheidend, um Innovationen zu ermöglichen und die digitale Souveränität Deutschlands im internationalen Kontext zu stärken. Ein aktuelles Positionspapier des RfII wird in diesem Kontext näher beleuchtet.
11:25 - 11:45 Die Erschließung von Spezialbeständen mit Wikidata, Wikisource & Co: Ein Pilotprojekt der Bibliothek des DHI Paris
Jens Bemme (SLUB Dresden), Ulrike Blumenthal (Deutsches Historisches Institut Paris)Veranstaltungsraum: RAUM B
Der Vortrag diskutiert Vorgehen, Sichtbarkeit und Potenziale offener und kooperativer Arbeitsweisen im Wikiversum für die Erschließung von Spezialbeständen einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek.
Wie kann eine wissenschaftliche Spezialbibliothek historische Bestände digital offen zugänglich machen – nachhaltig, kooperativ und mit vertretbarem Aufwand? Die Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Paris (DHIP) hat in einem Pilotprojekt die digitale Erschließung und Sichtbarmachung ausgewählter Spezialbestände mithilfe von Wikimedia-Werkzeugen erprobt (https://de.wikiversity.org/wiki/Projekt:Deutsches_Historisches_Institut_Paris_2025). Der Vortrag beleuchtet die verschiedenen Etappen dieses Pilotprojekts – von der Auswahl geeigneter Materialien über das praktische Arbeiten auf Wikisource, Wikidata und Wikimedia Commons bis hin zu Fragen der Nachhaltigkeit und Sichtbarkeit sowie der institutionellen Verankerung offener Arbeitsweisen. Dabei werden sowohl die Chancen für kleinere wissenschaftliche Bibliotheken als auch die Herausforderungen und Grenzen eines solchen kollaborativen und offenen Transkriptions- und Erschließungsprozesses reflektiert.
11:50 - 12:10 Offenheit gegenüber Digitalem und Offenheit von Digitalem – 10 Jahre E-preferred-Strategie in einer Hochschulbibliothek
Susanne Bader (Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich), Andreas Grossmann (Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich)Veranstaltungsraum: RAUM B
Seit 2016 werden elektronische Medien in der Anschaffung der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich systematisch bevorzugt (e-preferred). Das verlangt Offenheit gegenüber Digitalem, aber auch Offenheit von Digitalem. Eine Bestandsaufnahme.
Offenheit ist ein Leitprinzip der Bibliotheksarbeit. Sie spiegelt sich im öffentlichen Zugang und grosszügigen Platzangebot von Bibliotheken – oder in bewährten Partizipationsformen wie der Open Library. Nebst diesen physischen Dienstleistungen unterhält die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich ein breites Portfolio an digitalen Services, das zu grossen Teilen ebenfalls auf Offenheit setzt. Im Talk soll geklärt werden, wie Offenheit gegenüber Digitalem, aber auch Offenheit von Digitalem erreicht wird. Hinsichtlich des ersten Punkts blickt die Bibliothek auf eine bewegte Geschichte von nunmehr 10 Jahren E-preferred-Strategie zurück: Seit 2016 werden elektronische Medien in der Anschaffung systematisch bevorzugt, was zu einem massiven Shift im Erwerbungsbudget, zu einem kontinuierlichen Abbau physischer Titel sowie zu diversen Anpassungen, etwa im Controlling und der Klassifikation des Bestands oder in der Beratung und Kommunikation der Dienstleistungen führte. Die E-preferred-Strategie verlangte von den Mitarbeitenden, Fachreferierenden und Bibliotheksnutzenden früh und in hohem Masse Offenheit gegenüber Digitalem. Das zeigte sich besonders während gross angelegter öffentlicher Aussonderungsaktionen von physischen Dubletten, veralteten Auflagen und «Ladenhütern». Welche negativen und positiven Themencluster prägten den Diskurs rund um die E-preferred-Strategie in den letzten 10 Jahren? Im Talk wird ein Schlaglicht geworfen auf den Wandel von Nutzungsgewohnheiten, die Auswirkungen auf die Bestandsvielfalt und -kosten, die Abhängigkeit von Verlagen, die Kommunikation der «unsichtbaren» E-Medien oder die Erweiterung des Lernraums. Die Offenheit gegenüber Digitalem hängt dabei immer auch mit der Offenheit von Digitalem zusammen. Die Bibliothek berichtet von ihren eigenen Erfahrungen mit Zugangs- und Usabilityhürden des digitalen Bestands, mit Open Access und Open Educational Resources sowie mit gemeinsamen Initiativen wie swisscovery.