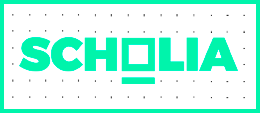4. Dezember 2025 : 11:00 - 12:20
Moderation: Tom Becker (Stadtbibliothek Hannover)
Veranstaltungsraum: RAUM B
11:00 - 11:25 Bibliotheken als Hubs für demokratische Teilhabe und digitale Souveränität im Netz: Wähle dein Format!
Katharina Leyrer (she/her) (FAU Erlangen-Nürnberg), Paula Mangold (sie/ihr) (Zentrum Liberale Moderne)Veranstaltungsraum: RAUM B
Wir stellen Formate vor, mit denen Bibliotheken Kompetenzen zu digitaler Souveränität und politischer Teilhabe im Netz vermitteln können. Für uns ist zentral: Welche Bedarfe gibt es in eurer Bibliothek?
Bürger*innen haben im Internet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, zu kommunizieren und an demokratischen Prozessen teilzuhaben. Dies bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich: Große Technologieunternehmen („Big Tech“) sammeln massenhaft Nutzer*innen-Daten und gefährden damit die Privatsphäre und Autonomie ihrer Nutzer*innen. Desinformation verbreitet sich teilweise schneller als gesicherte Fakten. Inhalte, die von einer KI generiert wurden, sind oft nicht als solche erkennbar. Um das Internet selbstbestimmt zu nutzen und um aktiv an demokratischen Prozessen teilzunehmen, benötigen wir daher unterschiedliche Kompetenzen. Bei der Vermittlung dieser Kompetenzen können Bibliotheken eine zentrale Rolle einnehmen. In diesem Workshop stellen wir verschiedene Themen und Formate vor, mit denen Bibliotheken Kompetenzen zu digitaler Souveränität und politischer Teilhabe im Netz vermitteln können: * Desinformation: Warum ist Desinformation ein Problem? Wie erkennen wir Desinformation im Netz und wie können wir mit ihr umgehen? * Aktiv im Netz ohne Big Tech: Welche Daten sammeln große Unternehmen über mich? Und welche Alternativen gibt es zu Diensten von Google, Meta, Apple und Co.? * Wissensgerechtigkeit: Wie können wir freies Wissen im Netz nutzen – und wie selbst dazu beitragen, z.B. in der Wikipedia? * Von der Online-Petition bis zum Meinungsblog: Wie können wir uns politisch aktiv im Netz einbringen? * KI für alle: Wie funktionieren KI-Systeme? Welche Gefahren bringen sie mit sich – und wie können wir einfache KI-Anwendungen selbst im Alltag nutzen? Anschließend wollen wir von euch wissen: Welche Bedarfe an Vermittlungsangeboten haben eure Nutzer*innen? Welche Angebote gibt es in eurer Bibliothek bereits? Welche Formate wünscht ihr euch? Gibt es aus eurer Sicht den Bedarf an Fortbildungen in diesem Bereich? Gemeinsam erstellen wir einen Ideenbaukasten mit Formaten für demokratische Teilhabe und digitale Souveränität im Netz. Wir freuen uns auf dich!
11:30 - 11:55 Gefunden werden statt suchen: Wie Bibliotheken digitale Offenheit aktiv mitgestalten können
Benjamin Degenhart (er/ihm) (FörderFunke)Veranstaltungsraum: RAUM B
KI schafft Abhängigkeit von kommerziellen Plattformen und proprietären Daten. Bibliotheken können als Wächter der Datensorgfalt und des Gemeinguts gegensteuern. Idee: ein Marktplatz für gemeinwohlorientierte Angebote, regelbasiert und datensparsam.
Ich möchte über die Offenheit sprechen, digitale Offenheit zu gestalten und über die Notwendigkeit, Offenheit zu strukturieren. KI-Tools sind zunehmend hilfreich und nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig schaffen sie Abhängigkeiten: von Expertise, gewaltiger Infrastruktur und Finanzkraft - allesamt geopolitische Spielbälle. Allzu leicht verführen KI-Tools dazu, es aufzugeben, selbst Ordnung und Logik in Daten zu bringen und sich stattdessen auf statistische Blackboxen zu verlassen. Bibliotheken haben eine unübertroffene Fachkompetenz darin, Informationen zu organisieren. In meinen Augen sind sie daher die idealen Wächter der “Datensorgfalt” im öffentlichen Raum. Ich möchte eine Projektidee vorstellen, die diese Aspekte aufgreift. Die letzten zwei Jahre habe ich am FörderFunke-Projekt gearbeitet, mit dem Ziel, Bürger*innen über staatliche Leistungen zu informieren, zu denen sie berechtigt sind: gefunden werden statt suchen zu müssen. Open Source, Linked Open Data und Privacy by Design sind dabei zentrale Prinzipien. Mit diesem Talk möchte ich diese Idee im Kontext von Bibliotheken weiterentwickeln. Über Angebote der öffentlichen Hand hinaus könnte man Bürger*innen direkt dazu ermächtigen, nicht-kommerzielle Angebote in Form von strukturierten “Auslösemustern” einzupflegen. So poppt dann vielleicht bei jemand anderem der Garagenflohmarkt um die Ecke oder die literarische Lesung im anderen Stadtteil auf. Es entsteht ein Marktplatz der Möglichkeiten. Die Datengrundlage ist dabei leichtgewichtig, offen und interoperabel für maximale Nachnutzung. Ich bin überzeugt, dass das Projekt einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert entfalten kann, weil es Informationsräume zugänglich macht. So sehen künstliche persönliche Assistenten richtig gemacht aus: regelbasiert und datensparsam. Gleichzeitig ist das Projekt durch die gewählten Prinzipien und Technologien ein aktives Statement für digitale Souveränität, transparente Algorithmen und den Schutz der Privatsphäre.
12:00 - 12:20 Digitale Offenheit praktisch gestalten – Entwicklung eines OER-Moodle-Plugins in abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
Claudia Hackl-Mayerhofer (Uni Vienna)Veranstaltungsraum: RAUM B
Digitale Offenheit beschreibt die transparente, zugängliche und partizipative Nutzung digitaler Technologien und Ressourcen, um Zusammenarbeit, Innovation und freien Wissensaustausch zu fördern. Doch wie sieht das in der Hochschulpraxis konkret aus?
In diesem Talk wird gezeigt, wie ein abteilungsübergreifendes Projekt unter enger Zusammenarbeit von Hochschuldidaktik, E-Learning, IT, Bibliotheken, Lehrenden und Studierenden nutzerzentrierte Lösungen entwickelt, die den Hochschulalltag offener und zugänglicher machen. Dabei werden sowohl Erfolgsfaktoren wie Kooperation zwischen Abteilungen, offene Standards und partizipative Prozesse als auch Herausforderungen diskutiert, die bei der Umsetzung digitaler Offenheit auftreten.
Teilnehmende erhalten Anregungen, wie digitale Offenheit in der eigenen Hochschule gefördert werden kann – von der Gestaltung offener Tools bis hin zu Impulsen für Zusammenarbeit, Lehre und Ressourcennutzung.