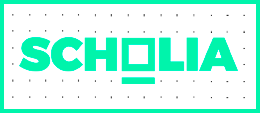3. Dezember 2025 : 14:20 - 15:35
Moderation: Tobias Bülte (hbz)
Veranstaltungsraum: RAUM A
14:20 - 14:40 OpenRewi – gemeinsam zu offenen rechtswissenschaftlichen Publikationen
Lasse Ramson (er/ihm) (Fachhochschule Potsdam), Katharina Trostorff (sie/ihr/they) (Fachhochschule Potsdam)Veranstaltungsraum: RAUM A
OpenRewi steht für offene Bildung in den Rechtswissenschaften. Der Verein entwickelt seit 2020 frei zugängliche, kollaborativ erstellte Lehrbücher und stärkt Strukturen für gemeinsames Publizieren.
Seit 2020 engagiert sich OpenRewi als Verein und Community in den Rechtswissenschaften für die Entwicklung offener Lehrmaterialien, insbesondere in der Erstellung und Publikation offener Lehrbücher. Diese entstehen kollaborativ in vielfältigen und divers zusammengesetzten Autor*innen-Teams. In der Session zeigen wir, wie die Publikationsprojekte, der Verein und die dahinterliegende Community of Practice zusammenwirken, und geben Einblicke in die Ziele der damit assoziierten wissenschaftlichen Projekte. Abschließend möchten wir mit den Teilnehmenden diskutieren, wie Infrastruktureinrichtungen – etwa Bibliotheken – zur Unterstützung einer offenen, communitygetragenen Erarbeitung von Publikationen beitragen können.
14:45 - 15:05 Die offene Bibliothek als digitalstrategisches Ziel
Roland Poellinger (er/ihm) (Münchner Stadtbibliothek)Veranstaltungsraum: RAUM A
Die Digitale Strategie der Münchner Stadtbibliothek setzt auf das Leitbild der ‚Offenen Bibliothek‘ – nicht nur im technischen Sinn, sondern mit der Frage, wie Bibliotheken im digitalen Wandel zu offenen Plattformen für die Stadtgesellschaft werden.
In der Digitalen Strategie der Münchner Stadtbibliothek bildet „Die offene Bibliothek“ das Kernziel: Die Gestaltung des vielschichtigen physischen, virtuellen und sozialen Bibliotheksraumes, der Lernen, Inspiration, Begegnung und kreative Beteiligung ermöglicht. Ausgehend vom dänischen Four-Spaces-Modell erläutere ich, wie wir dieses Konzept in München als strategischen Rahmen nutzen, um Offenheit systematisch in unsere digitale Entwicklung einzubetten. Der Vortrag skizziert den Weg von der Formulierung von Leitprinzipien bis zur Umsetzung konkreter Bausteine: Open-Library-Technologie für erweiterten Kundenservice, Open Content zur Zugänglichmachung lokaler Kulturschätze, Open Data/Open Metadata für die Sichtbarmachung unserer Bestände und als Einladung zur Partizipation, Open Source als Beitrag zu einer offenen digitalen Infrastruktur. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern um eine Kultur der Teilhabe, des Experimentierens und des Vertrauens – und um die Frage, wie Bibliotheken in Zeiten digitaler Transformation zu offenen Plattformen für ihre Stadtgesellschaft werden können. Ich freue mich auf den Austausch darüber, wie sich Offenheit als Haltung in digitalen Strategien verankern und in eine lebendige Community überführen lässt.
15:10 - 15:35 Open Educational Resources, Open Source und Open Data mit geringen Ressourcen umsetzen
Katharina Adrian-Herrmann (sie/ihr) (Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften)Veranstaltungsraum: RAUM A
Wie können Bibliotheken die Open Science Aspekte Open Source, Open Data und OER in ihre Services integrieren, wenn begrenzte Ressourcen (Finanzen, Personal etc.) zur Verfügung stehen? Der 2025 entwickelte Best-Practice-Leitfaden wird vorgestellt.
Wie auch die sich kontinuierlich weiterentwickelnde wissenschaftliche Praxis, unterliegen auch die Anforderungen an die Dienstleistungen zur Forschungsunterstützung einem Wandel. Die Digitalisierung der Wissenschaft hat eine Reihe von Folgeeffekten und Begleiterscheinungen zur Folge. Besonders die Open Science Teilaspekte Open Source, Open Data und Open Educational Resources (OER) sind von hoher Aktualität und bergen ein beträchtliches Potenzial für die Weiterentwicklung und Innovation. Die Integration dieser Themenbereiche in den Lehr- und Forschungsbetrieb ist aus mehreren Gründen als sinnvoll zu erachten. Zum einen kann dadurch die Innovationskraft der Forschung gefördert werden. Die Nutzung und Entwicklung von Open Source Software ermöglicht es Nutzer*innen innovative Projekte zu realisieren, die ohne den freien Zugang zu diesen Ressourcen nicht durchführbar wären. Des Weiteren fördert es die Transparenz und Effizienz. Die Nutzung von Open Data ermöglicht eine Optimierung von Verwaltungsprozessen sowie eine transparente Darstellung von Forschungsergebnissen. Dies führt zu einer Stärkung des Vertrauens in wissenschaftliche Arbeiten und deren administrative Abläufe. Ein weiterer Aspekt ist die Bildungsgerechtigkeit. Die Verfügbarkeit von OER trägt dazu bei, Bildungsinhalte für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, unabhängig von finanziellen oder geografischen Einschränkungen. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist: Wie können sich Bibliotheken in diesem Bereich sinnvoll aufstellen? Welche Services können sie etablieren, insbesondere wenn sie mit begrenzten Ressourcen (Finanzen, Personal etc.) zu kämpfen haben? Im Rahmen dieser Session soll der 2025 auf Basis von Interviews entwickelte Best-Practice-Leitfaden vorgestellt werden, der Antworten auf die aufgeworfenen Fragen bietet.